Von Nähe und Distanz
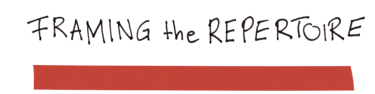
Mit FRAMING the REPERTOIRE wird mit Beginn dieser Spielzeit eine neue Programmlinie eingeführt, die sich dem Repertoire der Staatsoper Hamburg widmet. In der Vergangenheit entstandene Inszenierungen werden als Kunstform eigenen Rechts begriffen, an die es sich mit heutigen Perspektiven anzunähern gilt. Mit bewusstem Blick werden die Historizität von Repertoireproduktionen und die ihnen jeweils innewohnenden ästhetischen und zeitgeschichtlichen Dimensionen untersucht. Zugleich werden gegenwärtige Räume geschaffen, um gemeinsam mit anderen Nähe und Distanz zum Gesehenen genauer zu reflektieren. Die Veranstaltungen, bestehend aus Gesprächen, Vorträgen oder künstlerischen Impulsen, setzen sich unter anderem mit Regisseur:innen, Interpretationslinien oder mit Diskursen auseinander, die für spezifische Deutungsansätze zentral waren. Sie kontextualisieren somit das Repertoire.
Ein Opernhaus sollte kein Museum sein, so hört man immer wieder. Eine Aussage, die sich schickt, gut klingt, aber einer genaueren Betrachtung unterzogen werden muss. Denn: Opernhäuser sind durchaus auch Museen, versteht man diese nicht primär als Vergangenheit konservierende Orte, sondern als Orte lebendiger Gegenwart und beständiger, konstruktiver Auseinandersetzung mit Gewesenem. Dass weder Museen Stätten der Aufbewahrung von Gestrigem noch Opern reine Inkubatoren vom Heute sind, erklärt sich besonders durch einen Faktor: den Menschen, die Rezepient:innen, also Sie – das Publikum. In beiden Einrichtungen wird im Hier und Jetzt betrachtet, gehört und bestaunt. Kunst wird angebunden an ein Jetzt und überführt in ein Morgen. Denn Kunstwerke – ob auf der Bühne oder an der Wand – „ereignen“ sich erst durch die Betrachtung und dadurch in Gang gesetzte Interpretation. Sie tragen einerseits die Botschaften ihrer Entstehungszeit in sich, haben andererseits aber auch die Zeichen der Zeit seither aufgenommen. Zeichen, die sich in Inszenierungen manifestieren und durchaus problematische Botschaften wie Rassismus, Misogynie und andere diskriminierende Stereotype transportieren können. In der Vergangenheit entstandene Inszenierungen zeugen somit immer von sich verändernden Perspektiven auf die Welt. Sich als Publikum diesen unterschiedlichen Zeitebenen, die das Betrachtete in sich trägt, zu öffnen, kann anstrengend sein, birgt aber auch großes Potential für Bereicherung und Horizonterweiterung. Kultur als außeralltäglicher Ort des Menschlichen. Dafür braucht es Lust an gegenwärtiger Dechiffrierung.
Ein Gedankenexperiment:
Stellen wir uns vor, Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, wollen in dieser Spielzeit zwei Opernvorstellungen an unserem Haus besuchen. Die Hamburgische Staatsoper ist ein großer Repertoirebetrieb, in dem neben rund zehn Neuproduktionen pro Spielzeit etwa zwanzig „alte“ Inszenierungen auf dem Spielplan stehen. Manche Produktionen sind zwei Jahre alt, andere mehrere Jahrzehnte. (Auch wenn wir natürlich davon ausgehen, dass Sie für alle dreißig Aufführungen Tickets sichern werden, bleiben wir der Einfachheit halber hier bei zwei.) Ihre Wahl fällt auf Monster’s Paradise am 1. Februar 2026 und auf Tristan und Isolde am 21. Juni 2026. Gut vier Monate liegen zwischen den beiden Vorstellungen. Die Abende werden sich grundsätzlich voneinander unterscheiden, aber Ihr individuelles Ritual der zwei Besuche wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit größtenteils ähneln: An beiden Abenden mühen Sie sich ab, den Abend unter höchst möglichem Aufwand freizuhalten, rechtzeitig im Opernhaus zu erscheinen, die Tickets dabei zu haben (beide Male Parkett links, Platz 17 und 18, Reihe 12) und im besten Fall vorher nicht untereinander gestritten zu haben, damit die Vorzeichen für diesen Abend besser nicht sein könnten. So weit, so gut.
Unterschiede zwischen den beiden Abenden gibt es einige:
Monster’s Paradise ist eine Oper, die vor Ihnen niemand jemals erlebt hat. Sie werden also nicht nur einer Premiere, sondern zudem einer Uraufführung beiwohnen. Das ist eine Seltenheit. Monster’s Paradise ist das kongeniale Werk zweier Künstlerinnen unserer Zeit – Olga Neuwirth, Ernst-von-Siemens-Musiktpreisträgerin, und Elfriede Jelinek, Literaturnobelpreisträgerin. Es könnte uns schocken, was alles in diesem eineinhalbstündigen Musiktheater steckt. Es
ist ein absurdes Stück der Gegenwart über sich selbst – ein patriarchaler stumpfsinniger Polittyrann, der nicht mehr aufhören will, nach einer Wahl Stimmen zu zählen, die Welt ins Unheil zu stürzen versucht. Kein Ausweg scheint in Sicht. Ihnen, liebe Besucherin und lieber Besucher, dürfte es an gegenwärtigen Referenzen in Ihren Köpfen nicht mangeln.
Nun zu Besuch Nr. 2, bei dem die Decodierung etwas aufwendiger werden könnte: Tristan und Isolde feierte seine Uraufführung am 10. Juni 1865. Der Kern der Geschichte ist operntypisch: A und B lieben sich, Liebe ist jedoch nicht möglich (unter anderem wegen C). A und B sterben. (Dass beide sterben, stellt in der Oper eher eine Ausnahme dar. Für gewöhnlich hat die Frau für den Mann zu sterben, wodurch er Erlösung erfährt. Und, verzeihen Sie, zweiter Zusatz, ob von Sterben bei Tristan oder bei Isolde die Rede sein kann, ist zwar eine berechtigte und gute Frage, sprengt aber leider den hier zur Verfügung stehenden Rahmen.) Die legendäre Hamburger Inszenierung jedenfalls, von Regisseurin Ruth Berghaus erdacht, die Sie letztlich 161 Jahre später erleben werden, feierte am 13. März 1988 Premiere. Seit diesem Datum sind wiederum 38 Jahre vergangen, bis es schließlich zu Ihrem Besuch, zur Aufführung, kommt. Wenden wir uns also den weiteren Unterschieden der beiden Besuche zu. Der größte ist schnell ausgemacht: Sie erleben eine Uraufführung, und somit eine Neuproduktion sowie eine Repertoireaufführung. An diesem Punkt angelangt, wird es etwas komplizierter.
Das rezipierende Subjekt:
Die deutsche Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte schrieb 2004 in Ästhetik des Performativen:
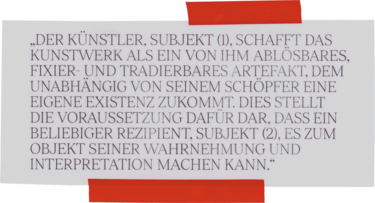
Differenzieren wir Subjekt (1) und fügen hierbei insgesamt drei Faktoren hinzu: (1a) Werk (Richard Wagners Tristan und Isolde), (1b) Inszenierung (Ruth Berghaus) und (1c) Aufführung (Künstlerinnen und Künstler in der Hamburgischen Staatsoper 2026). In der Aufführung, die Sie in Reihe 12 erfahren, haben Sie unumstößlich mit allen drei Faktoren zu tun. Und erst dann sind Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, an der Reihe: Denn Sie sind das rezipierende Subjekt. Erst durch Sie wird das Kunstwerk zu einem Objekt, das es wahrzunehmen und zu interpretieren gilt.
Wer hierbei mit Genauigkeit zu identifizieren versucht, wie weit das ganze Bühnengeschehen von einem selbst entfernt ist, droht zu scheitern. Der Frage nach Entfernung drängt sich immer auf, da sie stets einen Einfluss auf die wahrgenommene Relevanz hat. Das sich allabendlich auf der Bühne Ereignende birgt gleich mehrere Entfernungskonstanten in sich: physische Entfernung zu den Ausübenden (Stichwort: genaue Meterentfernung-Bühnenkante-zu-Reihe 12), auditive Entfernung (Stichwort: Lautstärkewahrnehmung in Reihe 12), der oben genannten Entfernungen zu den jeweils verschiedenen Zeiten (Stichwortkette: Idee, Libretto, Partitur, Uraufführung, Rezeption, Premiere der Inszenierung an der Hamburgischen Staatsoper, Wiederaufnahme, kurzum: Ihr Besuch) und die thematische Entfernung zur eigenen Lebensrealität (Stichworte: Ihre Rezeption und Ihr Erfahrungshorizont).
Ein Blick auf Tristan und Isolde mag dabei helfen, sich der Vertracktheit der Entfernungsproblematik auf emotionaler sowie intellektueller Ebene zu nähern: Wagner nannte das Werk nicht „Oper“, sondern schlicht und einfach „Handlung“. Bereits das erste Erklingen des unaufgelösten „Tristan-Akkords“ im Vorspiel macht klar, worum es bis zur allerersten Auflösung des Akkords nach 4,5 Stunden (in Worten: ja, viereinhalb!), gehen wird: Sehnsucht. Nicht nur um Ihre ganz persönliche Sehnsucht, endlich H-Dur erklingen zu hören, sondern um eine ein paar Ebenen in der menschlichen Wahrnehmung und Existenz tieferliegende: um unerfüllbare Sehnsucht – und zwar nicht nur die von Tristan oder von Isolde, sondern um unser aller unerfüllbaren Sehnsucht nach Liebe. Der Liebestod in dieser „Handlung“ ist eine logische Folge der kategorischen Unmöglichkeit einer absoluten Liebe in der irdischen Welt. So die Wagner’sche These 1865, seine Intention dürfte auch im Jahr 2026 noch unverändert geblieben sein.
Im dritten und letzten Aufzug stirbt Tristan und „sinkt langsam in ihren [Isoldes] Armen zu Boden“. Es wird noch über dreihundert Takte dauern, bis sie mit ihrem finalen, rund sieben Minuten dauernden, die „Handlung“ abschließenden Schlussgesang „Mild und leise“ beginnen wird. Und dann, so, wie schon der auf dieses Ende hinweisende Anfang des Vorspiels aus dem Nichts zu erwachsen schien, beginnt auch jetzt alles im leisesten Pianissimo. Am Ende von Isoldes Gesang wird es mächtig und laut. Es ereignet sich im Verlauf Unheimliches: Isolde meint zu sehen, wie der tote Tristan „das Auge / hold er öffnet“, wie sein Körper „immer lichter […] leuchtet“, wie das Herz ihm „muthig schwillt“, „wie den Lippen / wonnig mild / süßer Athem / sanft entweht“. Isolde meint, den toten Tristan wieder lebendig zu sehen.
Während das „geschieht“, sitzen Sie in Reihe 12. Sie sind damit verhältnismäßig nah dran und dürften Isoldes Gesang relativ intensiv erleben – das Pianissimo sehr leise, das Fortissimo sehr laut. Wagen wir im Gedankenexperiment kurz eine kleine Abänderung, damit klar wird, dass „näher gleich intensiver“ in die Irre führen kann: Säßen Sie, anstatt im Parkett rund zehn Meter von Isolde entfernt, im vierten Rang in der allerletzten Reihe, wäre das Erlebnis ein anderes. Sie wären mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen scheinbar paradoxen Widerspruch von Nähe und Distanz sehr intensiv nachhaltig betäubt. Isolde, sich in einer menschlichen Ausnahmeleistung gegen mehr als 100 Musikerinnen und Musiker seit mehreren Stunden im Graben durchsetzend, würde in den leisen Stellen noch leiser und in den lauten Stellen noch lauter wahrgenommen werden. Sie säßen in derselben Inszenierung, würden sie aber ganz anders erleben. Es ginge nicht mehr um Dezibel im rein physikalischen Sinn, sondern um ihre „wahrgenommenen“ Dezibel. Sie sähen die vierzig Meter Entfernung und würden unterbewusst diese in Relation zum dennoch sehr lauten Fortissimo setzen und extrapolieren, wie es sich wohl auf der Bühne anhören würde (sehr sehr laut!). Die Unterschiede zwischen Entfernung und Lautstärke hätten mitunter einen verstärkenden Effekt – Fazit: größere Distanz, vielleicht dennoch intensiver in Ihrer Wahrnehmung.
Liebe = unmöglich?
Das nun erst einmal zur isolierten physikalischen Wirkfähigkeit der Musik an unterschiedlichen Orten. Wie kompliziert es mit der Entfernung noch werden kann, zeigt der Blick auf die Relevanz. Was hat das eigentlich tief menschlich mit Ihnen zu tun? Sie, in Reihe 12 sitzend, werden sicherlich eine Meinung haben zum Thema „Liebestod“. Ob sich diese Haltung mit der Ihrer zweiten Karteninhaberin und dem Karteninhaber, (hätte für Sie beide ja vermutlich Konsequenzen), deckt, ist bereits fraglich. Was meint für Sie 2026 Liebestod – ein philosophisches Konstrukt, ein notwendiger Nagel, mit dem achtzig Prozent der Opern in die Wand geschlagen werden oder (um Himmels Willen bitte nicht) Ihre tatsächlich ins Auge gefasste Konsequenz, mit Ihrer Sehnsucht einer nicht möglichen irdischen absoluten Liebe umzugehen? Diese Fragen, die hier angerissen werden, zielen natürlich nur auf eines ab: Warum sitzen Sie überhaupt hier in Reihe 12 und schauen und hören zwei Menschen beim Sterben zu? Warum das für Sie alles relevant ist und warum Sie zum Glück immer wieder kommen, können nur Sie ganz individuell beantworten, aber die Auffächerungen der verschiedenen Ebenen der Aufführung von Richard Wagners Tristan und Isolde in der Regie von Ruth Berghaus können Futter für Hirn und Herz geben.
Wagen wir nun also einen Sprung ins Jahr 1988, das Inszenierungsjahr von Ruth Berghaus: Seit der Komposition von Tristan und Isolde ist einiges passiert – Industrialisierung, Kaiserreich, Jahrtausendwende, Ende der Monarchie, zwei Weltkriege, Hiroshima, Mauerbau, erste Mondlandung. Berghaus wird 1927 geboren, heiratet Paul Dessau, tritt 1962 der SED bei, wird 1971 Intendantin am Berliner Ensemble und weckt das Haus aus der damaligen ästhetischen Erstarrung. Ihr Hang zur unkonventionellen Programmatik und Auswahl der Regie führenden Künstlerinnen und Künstler erwirkt ihre Absetzung. Seit 1972 ist sie Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Ihre Loyalität zum Staat bringt ihr den Nationalpreis ein und die Möglichkeit auch außerhalb der DDR zu inszenieren. Von 1980 an ist sie als Regisseurin an der Oper Frankfurt tätig, kurz vor ihrem Hamburger Tristan inszeniert sie den kompletten Ring dort.
Berghaus’ Inszenierung von Tristan und Isolde kann als legendär bezeichnet werden. Sie eröffnet ein produktives Gegengewicht zu Wagner. Auf ihrer Reise in der Welten unendlichen Raum geht es primär nicht um den Tod, sondern um die Liebe im Leben. Diese künstlerische These von 1988 gilt es 2026 in einer späteren (38 Jahre älteren) veränderten Welt durch Sie in Reihe 12 auf Gültigkeit und Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Denn seither ist wiederum viel geschehen: Mauerfall, Wiedervereinigung, Jahrtausendwende, Einführung des Euro, Agenda 2010, Erstarken des Populismus, vier Kanzler:innen. Und weltweit natürlich noch mehr: Ende des Kalten Krieges, 9/11, Eurokrise, Covid-19, Trump (Monster’s Paradise), Klima- und kriegerische Krisen. Die Welt von heute ist eine andere, als sie es 1865 und 1988 war.
Kommen wir kurz vor Ende also wieder ganz zum Anfang: Oper sei kein Museum. Wendet man sich den unzähligen Fixpunkten der Vergangenheit zu, die für eine Repertoireaufführung relevant sind, wird augenfällig, dass das Museale sehr wohl einem Repertoirebetrieb inne wohnt. Es gibt viele Möglichkeiten, sich musiktheatralen Werken – denen es gewissermaßen eingeschrieben ist, interpretiert zu werden – und Inszenierungen – als interpretierenden Kunstform – zuzuwenden. Und gleichzeitig bleibt jeder Abend, jede Aufführung anders und einzigartig. In ihrer Ausgestaltung durch sämtliche Beteiligten, bedingt durch Ihre Wahrnehmungen. Mögliche Entfernungsebenen sind mannigfaltig, historische Kontexte ebenso. Ohne Annäherungen, ohne Verschiebungen in nah und fern würden der Reiz und die Chancen heutiger Repertoirebetriebe als Wunderkammern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verloren gehen.
Die Programmlinie FRAMING the REPERTOIRe möchte zu solchen Annäherungen anregen. Sie ist eine Einladung, sich durch zusätzliche Impulse letztlich selbst näher mit Werken und ihren szenischen und musikalischen Umsetzungen auseinanderzusetzen. Springen wir nochmal in Isoldes „Mild und leise“ und hören ihr abermals zu. Nachdem sie den Toten wieder lebend zu sehen glaubt, singt sie Folgendes: „Seht ihr, Freunde, / seht ihr’s nicht? […] Freunde, seht – / fühlt und seht ihr’s nicht?“. Nach viereinhalb Stunden Aufführung im Jahr 2026 einer 1988er-Inszenierung eines Kernrepertoirewerkes aus dem Jahr 1865 landen wir in einer gänzlich neuen Realität. Isolde hebt die Grenzen zwischen Betrachtenden und Ausführenden auf. Sie überschreitet Subjekt-Objektgrenzen. Und lädt ihre „Freunde“ aus dem Parkett zur Bildung einer Gemeinschaft ein: Nachdem wir die Ekstasen der Liebe, des gemeinsamen Denkens und Leidens der beiden miterlebt haben, sollen wir jetzt ganz und gar mit Isoldes Augen sehen, mit ihren Ohren hören. Sie, in Reihe 12, werden aufgefordert, sich eben in diesem Moment mit dem scheinbar wiederauferstehenden Tristan auseinanderzusetzen, zu ihrer Komplizin, ihrem Komplizen zu machen, einen Moment der völligen Verschmelzung zu erleben, mit offenem Herzen und offenen Ohren. Was für Kompliziertheiten die Trias „Werk – Inszenierung – Aufführung“ mit sich bringt! Und dadurch: Was für ein Potential Oper in sich trägt!