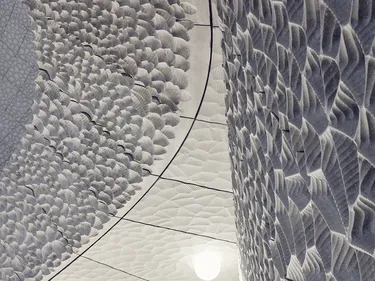In die Entstehungszeit der Symphonie Nr. 4 fallen für Peter Tschaikowsky (1840-1893) zwei Begegnungen, die von einschneidender Bedeutung für ihn waren. Im Dezember 1876 beginnt der Briefwechsel mit Nadeshda von Meck, einer überaus musikbegeisterten Frau, vermögende Witwe eines Besitzers mehrerer Eisenbahnstrecken – nicht weniger als 1204 Briefe sollten zwischen ihr und dem Komponisten bis 1890 gewechselt werden. Eine Beziehung der besonderen Art: Persönlich begegnet sind sich beide, ganz bewusst, nie; doch hat der Komponist seiner Briefpartnerin nicht nur tiefe Einblicke in seine musikalischen Überzeugungen, sondern auch in seine privatesten Gefühle erlaubt.
Parallel dazu tritt im Frühjahr 1877 überraschend die Musikstudentin Antonina Miljukowa in sein Leben, eine glühende Verehrerin (heute würde man sie eine Stalkerin nennen), die ihn mit ihren Liebesgeständnissen in die Enge treibt. Eine Verkettung von überhöhten Erwartungen, Missverständnissen und moralischen Skrupeln führt zu einer überstürzten Verlobung im Mai und der anschließenden Hochzeit. Sie stürzt den homosexuellen Künstler, der sicher vor allem aus gesellschaftlicher Rücksichtnahme dieser Verbindung zustimmt, in eine schwere psychische Krise. Auch dies ist immer wieder Thema in den Briefen an Frau von Meck.
Erstmals spricht Tschaikowsky über seine neue Symphonie am 1. (russ. Zeitrechnung)/13. Mai 1877, auch wenn Hauptthema des Briefes seine Bitte um finanzielle Unterstützung ist:
Jetzt bin ich beispielsweise völlig von einer Symphonie beansprucht, die ich bereits im Winter zu schreiben begonnen habe und ich Ihnen sehr gerne widmen möchte, da Sie, meiner Ansicht nach, in ihr einen Widerhall Ihrer geheimsten Gefühle und Gedanken finden müssten. Jede andere Arbeit wäre mir jetzt lästig, ich rede allerdings nur von einer Arbeit, die eine bestimmte Stimmung erfordert. Außerdem bin ich jetzt nervös, unruhig und gereizt, ein Zustand, der für das Komponieren nicht geeignet ist und sich ungünstig auf die Symphonie auswirkt, mit der ich nur langsam vorwärtskomme.
Ein wichtiges Thema wird die Frage der Widmung dieser Symphonie an die neue Brieffreundin. Nadeshda von Meck antwortet am 2./14. Mai:
Was die Widmung Ihrer Symphonie betrifft, so kann ich Ihnen sagen, dass Sie der einzige Mensch sind, von dem mir eine solche Widmung teuer und lieb wäre.
Am 27. Mai/8. Juni kommt er noch einmal auf die Widmung zurück, da er erfahren hat, dass Frau von Meck bisher grundsätzlich derlei Widmungen abgelehnt habe:
Für mich haben Sie eine Ausnahme gemacht, für die ich Ihnen unendlich dankbar bin. Sollte es Ihnen jedoch unangenehm sein, dass Ihr Name auf dem Titelblatt der Symphonie steht, so könnte man, falls Sie es wünschen, auch ohne ihn auskommen. Es würde ja genügen, wenn Sie und ich alleine wissen, wem die Symphonie zugeeignet ist. Bitte verfügen Sie darüber, wie es Ihnen beliebt.
Einen Monat später, am 26. Juni/8. Juli, greift Frau von Meck das Thema ein weiteres Mal auf:
Sie schrieben mir über Ihre Symphonie, Peter Iljitsch, und wollten meine Wünsche hinsichtlich der Widmung wissen. Ehe ich meinen Wunsch äußere, möchte ich eine Frage an Sie richten: Halten Sie mich für Ihren Freund? Ich, die grenzenlosen Anteil an Ihrer Arbeit nimmt… Falls Sie diese Frage mit einem Ja beantworten können, so würde ich mich sehr freuen, wenn die Widmung der Symphonie ohne Namensnennung einfach lauten könnte: ,Meinem Freunde gewidmet‘ (A mon cher ami)
Inzwischen ist es zu der Verlobung mit Antonina gekommen. Fünf Tage vor der Hochzeit, am 3./15. Juli, schildert der zutiefst verzweifelte Tschaikowsky ausführlich seine Situation, kommt aber auch noch einmal auf die Widmung zurück:
Ich kann die schrecklichen Gefühle, die mich seit diesem Abend quälen, nicht beschreiben. Das ist begreiflich. Im Alter von 37 Jahren mit einer angeborenen Abneigung gegen die Ehe nun plötzlich gewaltsam mit einer Frau, die man nicht liebt, verheiratet zu werden, ist sehr schwer. Ich muss meine ganze Lebensweise ändern…
Auf meine Symphonie schreibe ich: ,Meinem Freunde gewidmet‘, so wie Sie es vorgeschlagen haben. Das entspricht auch meinem Wunsch. Und nun leben Sie wohl, meine liebe, teure, gute Freundin. Wünschen Sie mir, angesichts der bevorstehenden Veränderung in meinem Leben, den Mut nicht zu verlieren. (…) Ich bitte Sie, anderen gegenüber die Umstände, die zu meiner Eheschließung führten, keineswegs zu erwähnen. Außer Ihnen weiß niemand etwas davon.
Die Hochzeit findet am 6./18. Juli statt, und um die Situation zu entschärfen, zieht sich der Komponist danach alleine auf das Gut seiner Schwägerin in Kamenka zurück. Erst nach und nach kehrt die Lust zu komponieren zurück. Mitte September kehrt Tschaikowsky nach Moskau zurück, wo seine junge Frau inzwischen die neue Wohnung eingerichtet hat. Doch die Lage spitzt sich dramatisch zu: Anfang Oktober erleidet der Komponist einen Nervenzusammenbruch und flieht nach St. Petersburg, danach folgt die Weiterreise mit Bruder Anatol nach Clarens an den Genfer See. In einem langen Brief schildert er Frau von Meck ungeschönt sein „Versagen“. Sie antwortet am 17./29. Oktober:
Nun weiß ich alles, was Sie durchgemacht haben, mein lieber Freund, und so leid es mir auch tut, dass Sie so gelitten haben, so freue ich mich doch über Ihren Entschluss, den entscheidenden Schritt zu tun, der unvermeidlich und der einzig richtige war. Früher erlaubte ich mir nicht, Ihnen meine aufrichtige Meinung zu sagen, weil sie nach einem Rat hätte aussehen können. Jetzt glaube ich jedoch auf Grund unserer Freundschaft berechtigt zu sein, Ihnen meine Ansicht über das Geschehene mitzuteilen.
Mitte Dezember meldet sich der Komponist aus Italien:
Dies ist der zweite Tag, an dem ich an meiner Symphonie arbeite, und zwar sehr beharrlich (4./16. Dez.) – Der erste Satz ist fast fertig. Ich kann voller Vertrauen sagen, das ist meine beste Komposition (6./18. Dez.) – Keines meiner früheren Orchesterwerke hat mich so viel Mühe gekostet, aber ich habe mich auch noch nie einer Sache mit solcher Liebe hingegeben. (…) Liebe Nadeshda Filaretowna, vielleicht irre ich mich, doch bin ich überzeugt, diese Symphonie ist kein mittelmäßiges Werk, sondern das Beste, was ich bisher komponiert habe. Wie ich mich freue, dass es unsere Symphonie ist, und dass Sie sie, wenn Sie sie eines Tages hören, wissen werden, dass ich bei jedem Takt an Sie gedacht habe. (9./21. Dez.)
Am Ende des Jahres schickt Tschaikowsky die vollständige Partitur nach Moskau; im Februar leitet Nikolai Rubinstein in Moskau die Uraufführung. Der Komponist verzichtet darauf, nach Russland zurückzukehren, aber er erwartet ungeduldig in Italien Nachrichten über die Reaktionen des Publikums. Frau von Meck zeigt sich enttäuscht von der mäßigen Qualität der Aufführung, spendet dem Werk selbst aber großes Lob. Zugleich fragt sie, ob der Symphonie ein bestimmtes Programm zugrunde liege. Tschaikowsky antwortet ausführlich am 17. Feb./1. März aus Florenz:
Die Einleitung (zum 1. Satz) ist das Samenkorn der ganzen Symphonie und zweifellos der Hauptgedanke. Das ist das Fatum, die verhängnisvolle Macht, die unser Streben nach Glück verhindert und eifersüchtig darüber wacht, dass Glück und Frieden nie vollkommen und wolkenlos werden, eine Macht, die wie ein Damoklesschwert über unserm Haupte schwebt und unsere Seele unentwegt vergiftet.
Danach scheinen zarte Träume auf, so Tschaikowsky, doch der weitere Verlauf des Satzes folge den Wechselfällen des Lebens, jenem Hin und Her zwischen „harter Wirklichkeit und flüchtigen Träumen vom Glück“. Der zweite Satz drücke „eine Trauer anderer Art aus: die Schwermut“, die einen umfängt, wenn „ein Schwarm von Erinnerungen an die Jugend“ auftauche. Der dritte Satz enthalte vor allem „kapriziöse Arabesken, unfassliche Gestalten, die von der Fantasie geschaffen, vorbeischweben…“
Die positive Auflösung der vielen düsteren Gedanken bringt, mit den Worten Tschaikowskys, dann der vierte Satz:
Wenn du in dir selbst keine Freude finden kannst, so blicke um dich. Geh ins Volk! Schau, wie es sich dem Vergnügen, der ungehemmten Freude hingibt. (…) O wie fröhlich sie sind! Beschuldige dich selbst und erkenne, dass in der Welt nicht alles Traurigkeit ist. Es gibt einfache, aber starke Freuden. Freue dich am Glück der anderen. Das Leben kann erträglich werden.